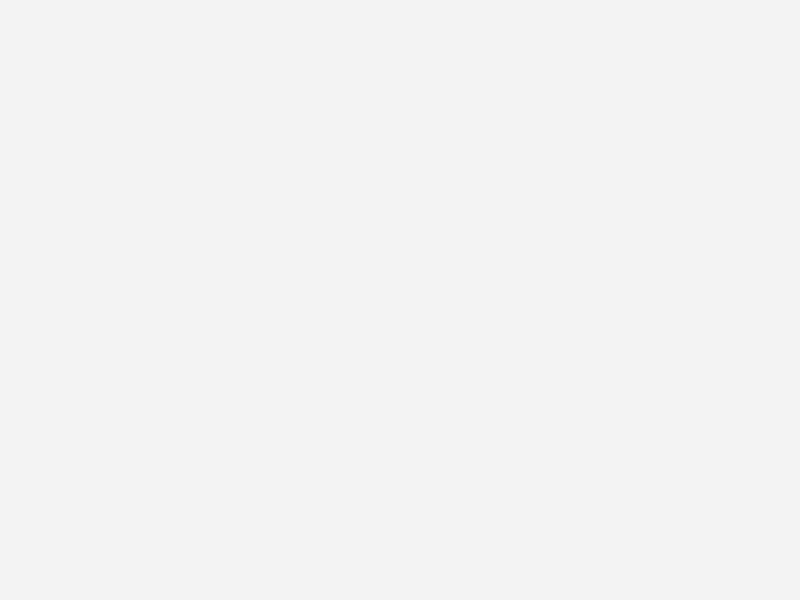
Die aktuellen Berichte zur Antibiotikaresistenz in der EU zeigen für 2023 rückläufige Raten von Blutstrominfektionen durch Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) sowie durch gegenüber Cephalosporinen der dritten Generation resistente Escherichia coli-Stämme im Vergleich zu 2019 [1]. Allerdings kam es im gleichen Zeitraum zu einem Anstieg der Blutstrominfektionen durch Klebsiella pneumoniae um mehr als 50 %. Diese Entwicklung gefährdet das Ziel, die Resistenzraten bis 2030 um 5 % zu senken [1]. Trotz der positiven Trends bei einigen Erregern ist der deutliche Anstieg der K. pneumoniae-Infektionen ein ernstes Problem für die öffentliche Gesundheit. Sollten die Zahlen weiter steigen, wird die EU ihre Ziele zur Eindämmung antimikrobieller Resistenzen (AMR) bis 2030 nicht erreichen [1].
Nicht nur Blutstrominfektionen beeinflussen die AMR-Rate in der EU: Auch Infektionen im Mund- und Rachenraum gehören zu den Hauptursachen für den unangemessenen Einsatz von Antibiotika. Viele dieser Infektionen wären mit lokalen Therapien gut behandelbar – stattdessen werden häufig Antibiotika verschrieben, was die Resistenzentwicklung zusätzlich befeuert [2]. Ein Beispiel ist die Pharyngitis, also die klassische Halsentzündung, die oftmals unnötig mit Antibiotika behandelt wird, obwohl alternative Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen [2].
Eine dieser Alternativen sind oral angewendete Lutschtabletten mit Octenidin. Sie sind aufgrund der einfachen Einnahme und der verlängerten Kontaktzeit mit der Schleimhaut pharmakodynamisch vorteilhaft [2]. Unklar ist jedoch, welchen Einfluss sie auf das Mikrobiom von Mund, Rachen und Darm haben, insbesondere ob sie wichtige kommensale Mikroorganismen beeinträchtigen, die eine wesentliche Rolle für die Aufrechterhaltung der mikrobiellen Balance spielen [2]. Für klinische Anwender ist es daher entscheidend zu verstehen, wie Octenidin-haltige Lutschtabletten sowohl hinsichtlich ihrer antimikrobiellen Wirkung als auch ihrer Auswirkungen auf Kommensalen zu bewerten sind – nur so können fundierte Therapieentscheidungen getroffen und Patienten hinsichtlich der mikrobiologischen Sicherheit beraten werden.
Junka et al. untersuchten die antimikrobielle Aktivität von Octenidindihydrochlorid gegenüber 106 mikrobiellen Stämmen, darunter sowohl pathogene als auch kommensale Mikroorganismen aus Mundhöhle, Darm und Rachen. Zu den getesteten Erregern zählten unter anderem MRSA, Streptococcus pyogenes, E. coli, Candida albicans sowie Bacteroides-Arten – letztere sind strikt anaerobe Darmbewohner und wurden unter streng anaeroben Bedingungen in einer Whitley A35 Anaerobe Arbeitsstation (85 % N₂, 10 % H₂, 5 % CO₂) kultiviert. Die initiale antimikrobielle Aktivität wurde mittels modifiziertem Agar-Diffusionstest geprüft, anschließend wurden minimale bakterizide Konzentrationen (MBC) über Mikrodilution bestimmt.
Bei verschiedenen Kontaktzeiten und physiologisch relevanten Konzentrationen zeigte Octenidindihydrochlorid MBC-Werte unter 260 mg/L gegenüber Mikroorganismen aus Mund- und Rachenraum. Gegen kommensale Darmbakterien hingegen ließ sich bei einer Konzentration von 0,05 mg/L kein bakterizider Effekt nachweisen. Octenidindihydrochlorid war.
Verfasst von DWS Mikrobiologin Kirsty McTear
Referenzen
- European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial resistance in the EU/EEA (EARS-Net) - Annual Epidemiological Report 2023 [Internet]. European Centre for Disease Prevention and Control. 2024. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/antimicrobial-resistance-eueea-ears-net-annual-epidemiological-report-2023
- Junka A, Malwina Brożyna, Paweł Krzyżek, Tomczyk M, Krasucki K, Matys T, et al. Octenidine Lozenges Intended for Oral Administration Display In Vitro Activity Against Oropharyngeal Pathogens and Safety Toward Intestinal Microbiota. International Journal of Molecular Sciences. 2025 Oct 15;26(20):10045–5.


 de
de
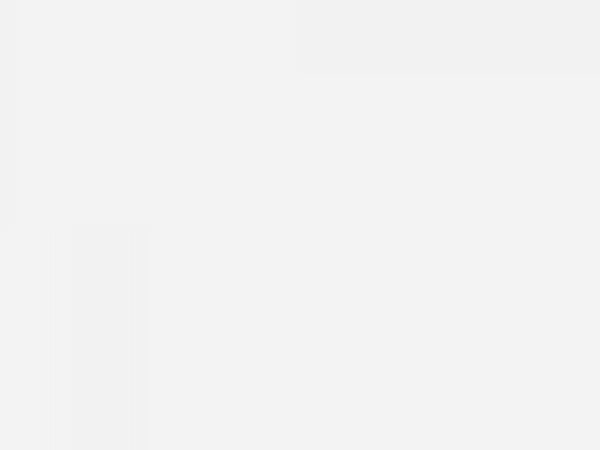
 xEnglish
xEnglish